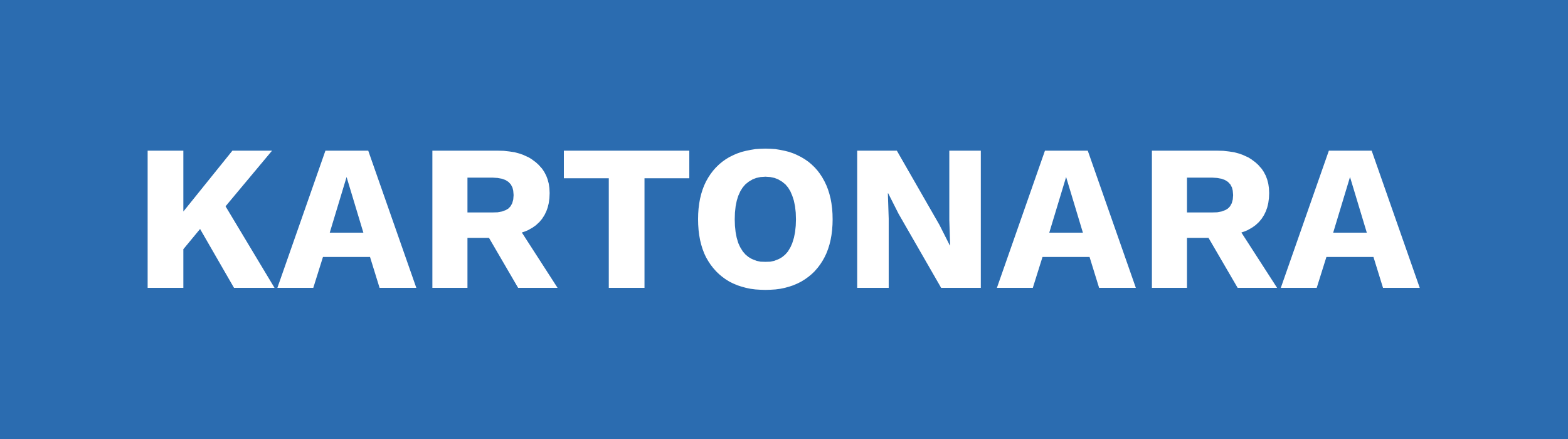Ein Umzug in eine neue Wohnung bringt für die meisten Menschen nicht nur organisatorische Herausforderungen, sondern auch eine nicht zu unterschätzende finanzielle Belastung mit sich. Neben möglichen Schönheitsreparaturen in der alten oder neuen Wohnung und der oft unvermeidbaren Doppelbelastung durch zwei Mieten gleichzeitig, fallen auch die Kosten für den Umzug selbst an – selbst wenn man günstige und hochwertige Umzugskartons findet. Doch eine der größten finanziellen Hürden ist oft die Mietkaution, auch Mietsicherheit genannt. Der Vermieter hat das Recht, bis zu drei Kaltmieten als Sicherheitsleistung zu verlangen. Für viele Mieter bedeutet das eine erhebliche Belastung. Zusätzlich kann es problematisch werden, wenn die Kaution der alten Wohnung noch nicht ausgezahlt wurde, während gleichzeitig die neue Kaution fällig ist. Doch wie sind die rechtlichen Regelungen hier? Darf der Vermieter die Mietkaution zurückhalten? Welche Rechte und Pflichten bestehen für Mieter und Vermieter?
Was versteht man unter Mietkaution bzw. Mietsicherheit?
Der Vermieter kann von einem neuen Mieter eine finanzielle Sicherheitsleistung verlangen, um sich gegen mögliche finanzielle Schäden abzusichern. Die Höhe dieser Mietkaution darf maximal drei Monatskaltmieten betragen, wobei der Vermieter auch eine niedrigere Summe anfordern oder ganz auf eine Kaution verzichten kann. Es besteht außerdem die Möglichkeit, die Gesamtzahlung in bis zu drei Raten zu leisten. Wichtig ist, dass die Wohnung bereits nach Zahlung der ersten Rate übergeben wird.
Wichtig: Eine Mietkaution muss ausdrücklich im Mietvertrag vereinbart sein. Eine nachträgliche Forderung dieser Sicherheitsleistung ist nur mit Zustimmung des Mieters zulässig. Ebenso ist eine spätere Erhöhung des Kautionsbetrags ausgeschlossen.
Der Hauptzweck der Mietkaution besteht darin, den Vermieter vor möglichen finanziellen Verlusten zu schützen. Dazu zählen unter anderem:
- Die Absicherung gegen ausstehende Mietzahlungen, insbesondere zum Ende des Mietverhältnisses,
- Die Deckung von Kosten für Schönheitsreparaturen, die der Mieter trotz vertraglicher Vereinbarung nicht vorgenommen hat,
- Die Begleichung offener Nebenkosten nach Vertragsende.
Wie muss die Mietkaution angelegt werden?
Sowohl Mieter als auch Vermieter sind oft unsicher darüber, wie genau die Mietkaution verwaltet werden muss. Häufig wird fälschlicherweise angenommen, dass Mieter die Kaution mit den letzten Mietzahlungen verrechnen können – das ist jedoch nicht erlaubt. Auch Vermieter begehen oft Fehler, indem sie die Kaution nicht korrekt anlegen.
Rechtlich ist klar geregelt, dass die Kaution vom restlichen Vermögen des Vermieters getrennt verwaltet werden muss. Dies schützt den Mieter, falls der Vermieter insolvent wird. Denn im Falle einer Insolvenz ohne getrennte Anlage könnte der Mieter seine Kaution vollständig verlieren.
Der Vermieter ist daher verpflichtet, die Kaution
- getrennt von seinem eigenen Vermögen auf einem speziellen Kautionskonto anzulegen,
- ausschließlich für die gesetzlich vorgesehenen Zwecke zu verwenden,
- und bei Vertragsende inklusive Zinsen zurückzuzahlen.
Mieter haben ein Recht darauf, vom Vermieter die Art und Weise der Anlage nachzuweisen. Werden die gesetzlichen Vorgaben nicht eingehalten, kann der Mieter Schadensersatz verlangen. Dabei muss die Verzinsung marktüblich sein, mit Ausnahme von Vermietern von Jugend- und Studentenwohnheimen.
Die Kaution darf erst nach Beendigung des Mietverhältnisses vom Vermieter genutzt werden, etwa um offene Forderungen zu begleichen, jedoch immer nur unter Einhaltung der gesetzlichen Regeln.
Besondere Situationen: Insolvenz, Erbschaft und Verkauf der Immobilie
Es gibt spezielle Fälle, die für den Mieter wichtig sind, da sie die Handhabung der Kaution beeinflussen können:
- Insolvenz des Vermieters: Wenn der Vermieter insolvent wird und die Kaution nicht separat angelegt hat, fällt die Summe in die Insolvenzmasse. Der Mieter riskiert, sein Geld komplett zu verlieren, auch wenn er theoretisch Anspruch auf Schadensersatz wegen falscher Anlage hat – diesen Anspruch kann er in der Praxis kaum durchsetzen.
- Tod des Vermieters: Im Todesfall treten die Erben des Vermieters automatisch in den Mietvertrag ein und übernehmen damit auch die Verantwortung für die Mietkaution, die ihnen später ausgezahlt wird, vorausgesetzt sie wurde ordnungsgemäß angelegt.
- Verkauf der Immobilie: Wechselt die Immobilie den Besitzer, übernimmt der neue Eigentümer automatisch alle Rechte und Pflichten aus dem Mietvertrag, einschließlich der Mietkaution.
Rückzahlung der Mietkaution – wann und wie?
Die Mietkaution ist nach Ende des Mietverhältnisses zurückzugeben. Allerdings bedeutet das nicht, dass die Rückzahlung unmittelbar mit dem Auszug erfolgen muss. Der Vermieter darf sich eine angemessene Frist nehmen, um zu überprüfen, ob noch Ansprüche gegen den Mieter bestehen, etwa offene Mietzahlungen oder Kosten für Reparaturen.
Die gesetzliche Regelung gibt keine feste Frist vor, aber die Rechtsprechung orientiert sich an einem Zeitraum von etwa zwei bis sechs Monaten. Falls die Nebenkostenabrechnung für das letzte Mietjahr noch nicht vollständig vorliegt, kann die Rückzahlung auch länger hinausgezögert werden.
Wichtig ist, dass die Kaution verzinst wird. Die Verzinsung beginnt mit der Einzahlung und endet mit der Rückzahlung – nicht mit dem Mietvertragsende. Je später die Rückzahlung erfolgt, desto mehr Zinsen muss der Vermieter zahlen.
- Keine offenen Ansprüche: Hat der Vermieter keine Forderungen mehr, muss er die gesamte Kaution inklusive Zinsen auszahlen.
- Offene Forderungen: Wenn noch Forderungen bestehen, darf der Vermieter diese mit der Kaution verrechnen. In der Praxis empfiehlt sich jedoch, die Nachforderungen separat geltend zu machen und danach die Kaution vollständig zurückzuzahlen, um Transparenz zu schaffen und Streitigkeiten zu vermeiden.
Ein detailliertes Übergabeprotokoll bei Wohnungsübergabe hilft dabei, mögliche Konflikte zu vermeiden. Dokumentieren beide Seiten gemeinsam den Zustand der Wohnung, kann der Vermieter später keine unbegründeten Ansprüche stellen.
Was tun, wenn die Kaution nicht zurückgezahlt wird?
Kommt es zu einer nicht gerechtfertigten Verzögerung bei der Rückzahlung, kann der Mieter seine Kaution einfordern. Zunächst sollte der Mieter freundlich um die Auszahlung bitten, danach schriftlich mit einer Fristsetzung (ideal per Einschreiben mit Rückschein) nachhaken. Falls keine Einigung erzielt wird, kann Beratung beim Mieterschutzbund oder einer ähnlichen Organisation hilfreich sein. Als letzter Schritt steht der gerichtliche Weg offen – etwa über einen Mahnbescheid oder Klage.
Verjährungsfristen für die Rückzahlung der Mietkaution
Der Anspruch auf Rückzahlung der Kaution verjährt nach drei Jahren. Diese Frist beginnt jeweils am Ende des Kalenderjahres, in dem der Mieter seine Rückzahlungsansprüche geltend machen konnte. Das bedeutet, dass der Mieter spätestens bis zum 31. Dezember des dritten Jahres nach Auszug seine Ansprüche anmelden muss, sonst verfällt sein Recht auf Rückzahlung.
An wen wird die Kaution ausgezahlt?
Am Ende des Mietverhältnisses stellt sich die Frage, wer die Kaution erhält – insbesondere wenn mehrere Personen im Mietvertrag stehen:
- Paar oder Familie als Mieter: Der Vermieter zahlt die gesamte Kaution an einen der Vertragspartner aus und ist damit rechtlich aus der Haftung entlassen. Bei Trennung empfiehlt sich eine einvernehmliche Lösung oder eine Vertragsänderung.
- Wohngemeinschaft (WG): Häufig gibt es einen Hauptmieter, der die Kaution hinterlegt. Die Rückzahlung erfolgt an diesen. Sollte der Hauptmieter ausziehen, muss der Vertrag angepasst und eine neue Kaution hinterlegt werden.
- Dritter zahlt Kaution: Wird die Kaution von einem Dritten gestellt, zahlt der Vermieter dennoch an den im Mietvertrag genannten Mieter. Eine Alternative ist, den Dritten vertraglich als Gläubiger zu benennen, sodass die Kaution direkt an ihn zurückgezahlt wird.
Alternative Lösungen zur klassischen Mietkaution
Wegen der finanziellen Belastung durch die Kaution nutzen immer mehr Mieter und Vermieter alternative Modelle wie Mietkautionsbürgschaften oder Mietkautionsversicherungen. Dabei übernimmt eine Versicherung die Bürgschaft für den Mieter und garantiert dem Vermieter die Kautionssumme bis zu einem bestimmten Betrag.
Diese Modelle erleichtern die Abwicklung, da kein separates Kautionskonto erforderlich ist. Der Vermieter hat bei berechtigten Ansprüchen einen direkten Ansprechpartner in der Versicherung, und der Mieter zahlt statt der hohen Kaution lediglich eine vergleichsweise geringe Prämie. Damit kann die Mietkautionsbürgschaft eine sinnvolle finanzielle Entlastung bei einem Umzug darstellen.